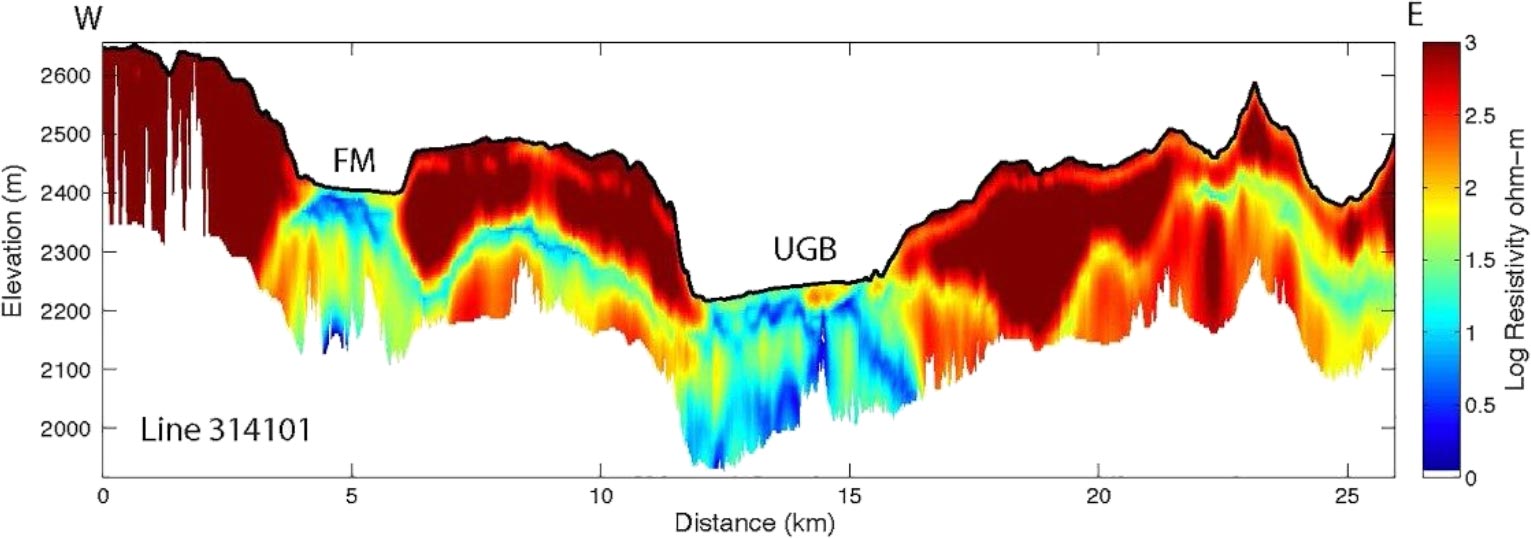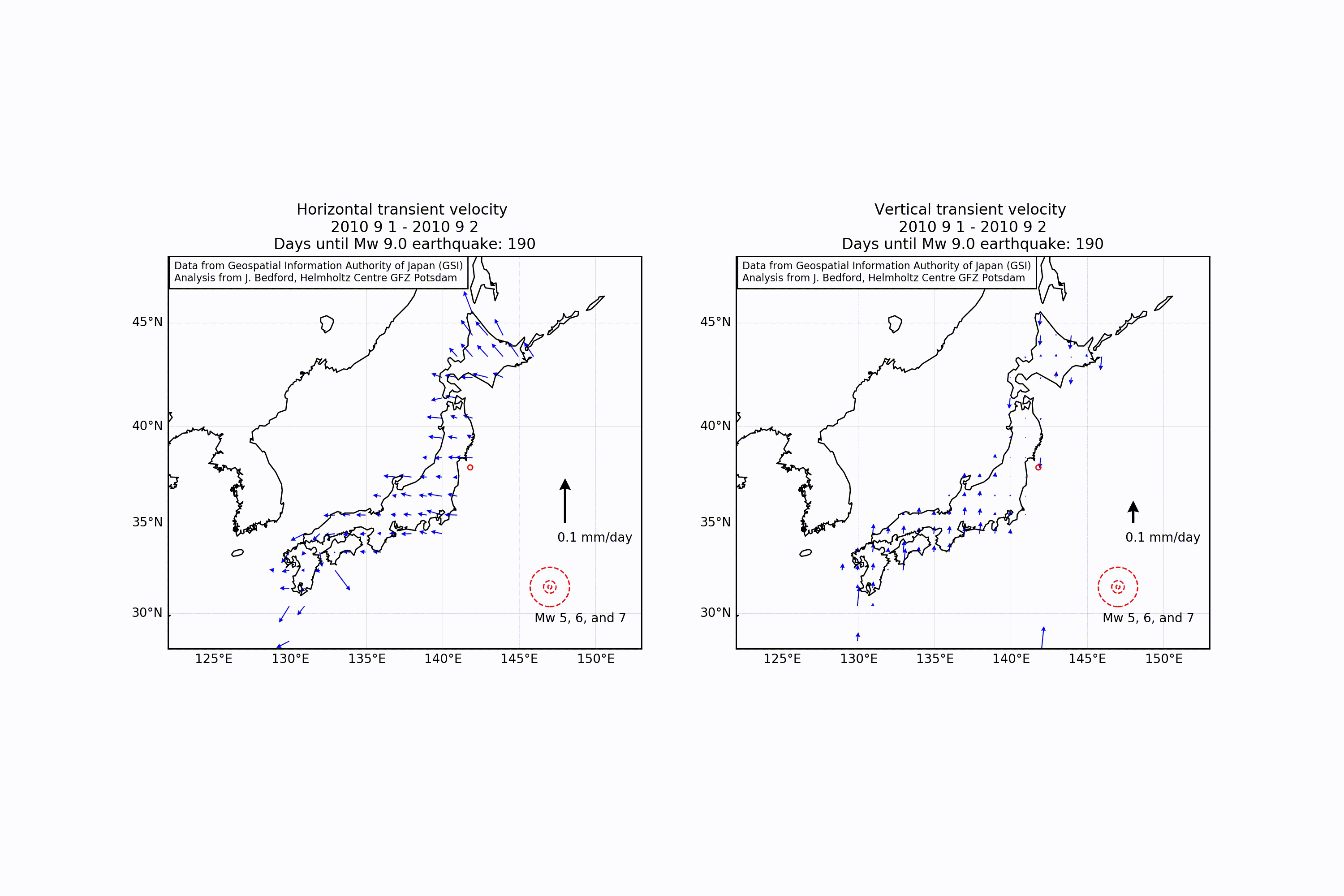Im US-Amerikanischen Bundesstaat North Dakota wurde ein sensationeller Fossilfund gemacht, der die These des Massensterbens vor 66 Millionen Jahren, durch einem Asteroideneinschlag vor Mexiko belegt. Bei dem Fund handelt es sich um Bein und Haut eines Dinosauriers der Art Thescelosaurus, der in der Grabungsstätte Tanis gemacht wurde. Dort wird seit 2019 nach Fossilien gegraben und es wurden bereits bedeutende Funde gemacht, die die These des großen Artensterbens durch den Chicxulub-Asteroiden unterstützen. Dazu zählen Fossilien von störartigen Fische, in deren Kiemen Glaskügelchen gefunden wurden, die durch Schmelzen von Gesteinen infolge des Asteroideneinschlags stammten. Solche Schmelzkügelchen nennt der Fachmann Mikrotektite. Bei Tektiten handelt es sich im Allgemeinen um Schmelzgestein, dass bei Meteoriteneinschlägen entsteht. Obsidian wäre ein vulkanisches Äquivalent, allerdings kann es sich chemisch von Tektiten unterscheiden.
Tektite und Iridium belegen Asteroideneinschlag vor 66 Millionen Jahren
 Das nun präsentierte Fossil des Thescelosaurus, stellt einen Höhepunkt der Grabungen dar. Es ist das erste Dinosaurierfossil, dass genau aus der Zeit des Einschlags stammt und dieser zweifelsfrei zugeordnet werden kann. Die Forscher um den Paläontologen Robert De Palma gehen davon aus, dass der Thescelosaurus direkt durch den Asteroideneinschlag getötet wurde. Dafür sprechen die Gesteinsschichten, in denen das Fossil gefunden wurde: in den Schichten wurden nicht nur die Fische mit den Glasresten in den Kiemen gefunden, sondern auch ungewöhnlich viel Iridium. Das seltene Element der Platiniumgruppe kommt auf der Erde in nur sehr geringen Konzentrationen vor. Sein Anteil ist in Asteroiden/Meteoriten allerdings weitaus höher. Schlägt ein großer Asteroid ein, entsteht eine Sedimentschicht mit erhöhter Iridium-Konzentration, so wie es vor ca. 66 Millionen Jahren der Fall war, als der Asteroid im mexikanischen Yucatan einschlug und den Chicxulub-Krater schuf. Damals entstanden nicht nur gewaltige Druck- und Flutwellen, sondern es wurden Unmengen an Staub und Aerosolen in die Atmosphäre eingetragen, die sich weltweit verteilten. Einige größere Bruchstücke regneten im großen Umkreis nieder und sind bis in den Weltraum aufgestiegen. Einige der Bruchstücke wurden im 3000 km entfernten Tanis gefunden. Vielleicht erschlug sogar ein Gesteinsbruchstück den kleinen Dinosaurier, dessen fossilisiertes Bein nun soviel Aufregung in der Fachwelt verursacht.
Das nun präsentierte Fossil des Thescelosaurus, stellt einen Höhepunkt der Grabungen dar. Es ist das erste Dinosaurierfossil, dass genau aus der Zeit des Einschlags stammt und dieser zweifelsfrei zugeordnet werden kann. Die Forscher um den Paläontologen Robert De Palma gehen davon aus, dass der Thescelosaurus direkt durch den Asteroideneinschlag getötet wurde. Dafür sprechen die Gesteinsschichten, in denen das Fossil gefunden wurde: in den Schichten wurden nicht nur die Fische mit den Glasresten in den Kiemen gefunden, sondern auch ungewöhnlich viel Iridium. Das seltene Element der Platiniumgruppe kommt auf der Erde in nur sehr geringen Konzentrationen vor. Sein Anteil ist in Asteroiden/Meteoriten allerdings weitaus höher. Schlägt ein großer Asteroid ein, entsteht eine Sedimentschicht mit erhöhter Iridium-Konzentration, so wie es vor ca. 66 Millionen Jahren der Fall war, als der Asteroid im mexikanischen Yucatan einschlug und den Chicxulub-Krater schuf. Damals entstanden nicht nur gewaltige Druck- und Flutwellen, sondern es wurden Unmengen an Staub und Aerosolen in die Atmosphäre eingetragen, die sich weltweit verteilten. Einige größere Bruchstücke regneten im großen Umkreis nieder und sind bis in den Weltraum aufgestiegen. Einige der Bruchstücke wurden im 3000 km entfernten Tanis gefunden. Vielleicht erschlug sogar ein Gesteinsbruchstück den kleinen Dinosaurier, dessen fossilisiertes Bein nun soviel Aufregung in der Fachwelt verursacht.
Dinosaurier Thescelosaurus hatte Vogelfüße
 Thescelosaurus war ein vogelähnlicher Saurier, der zwar nicht gefiedert war, aber Beine und Füße hatte, die sich am Besten mit dem Vogel Straus vergleichen lassen. Die Forscher gehen davon aus, dass der Saurier nicht an den Spätfolgen des Impakts starb, sondern unmittelbar, zu Beginn der Katastrophe. Die meisten Dinosaurier dürften hingegen einen langsamen und qualvollen Tod erlitten haben, denn sie Verhungerten infolge des globalen Winters, der die Erde mehrere Jahrtausende im Griff gehabt haben dürfte. Das Ereignis leitete nicht nur das Sterben der Saurier ein, sondern einen Großteil allen Lebens auf der Erde. Der Einschlag markiert das Ende der Kreidezeit, und eine Zeitenwende, die den Aufstieg der Säugetiere mit sich brachte.
Thescelosaurus war ein vogelähnlicher Saurier, der zwar nicht gefiedert war, aber Beine und Füße hatte, die sich am Besten mit dem Vogel Straus vergleichen lassen. Die Forscher gehen davon aus, dass der Saurier nicht an den Spätfolgen des Impakts starb, sondern unmittelbar, zu Beginn der Katastrophe. Die meisten Dinosaurier dürften hingegen einen langsamen und qualvollen Tod erlitten haben, denn sie Verhungerten infolge des globalen Winters, der die Erde mehrere Jahrtausende im Griff gehabt haben dürfte. Das Ereignis leitete nicht nur das Sterben der Saurier ein, sondern einen Großteil allen Lebens auf der Erde. Der Einschlag markiert das Ende der Kreidezeit, und eine Zeitenwende, die den Aufstieg der Säugetiere mit sich brachte.
Grabungsstätte Tanis wurde von Duckwelle erfasst
 In Tanis fand man sogar eine gepfählte Schildkröte, ein Zeugnis dafür, dass selbst in 3000 km Entfernung zum Einschlagsort noch Äste wie Speere durch die Luft zischten. Interessanterweise zählen Schildkröten zu den wenigen Überlebenden der Katastrophe.
In Tanis fand man sogar eine gepfählte Schildkröte, ein Zeugnis dafür, dass selbst in 3000 km Entfernung zum Einschlagsort noch Äste wie Speere durch die Luft zischten. Interessanterweise zählen Schildkröten zu den wenigen Überlebenden der Katastrophe.
Die Details der Forschungen gelangten mal nicht über eine Forschungsarbeit ans Licht der Öffentlichkeit, sondern über eine Fernseh-Dokumentation der BBC, die von Altmeister David Attenborough präsentiert wurde.