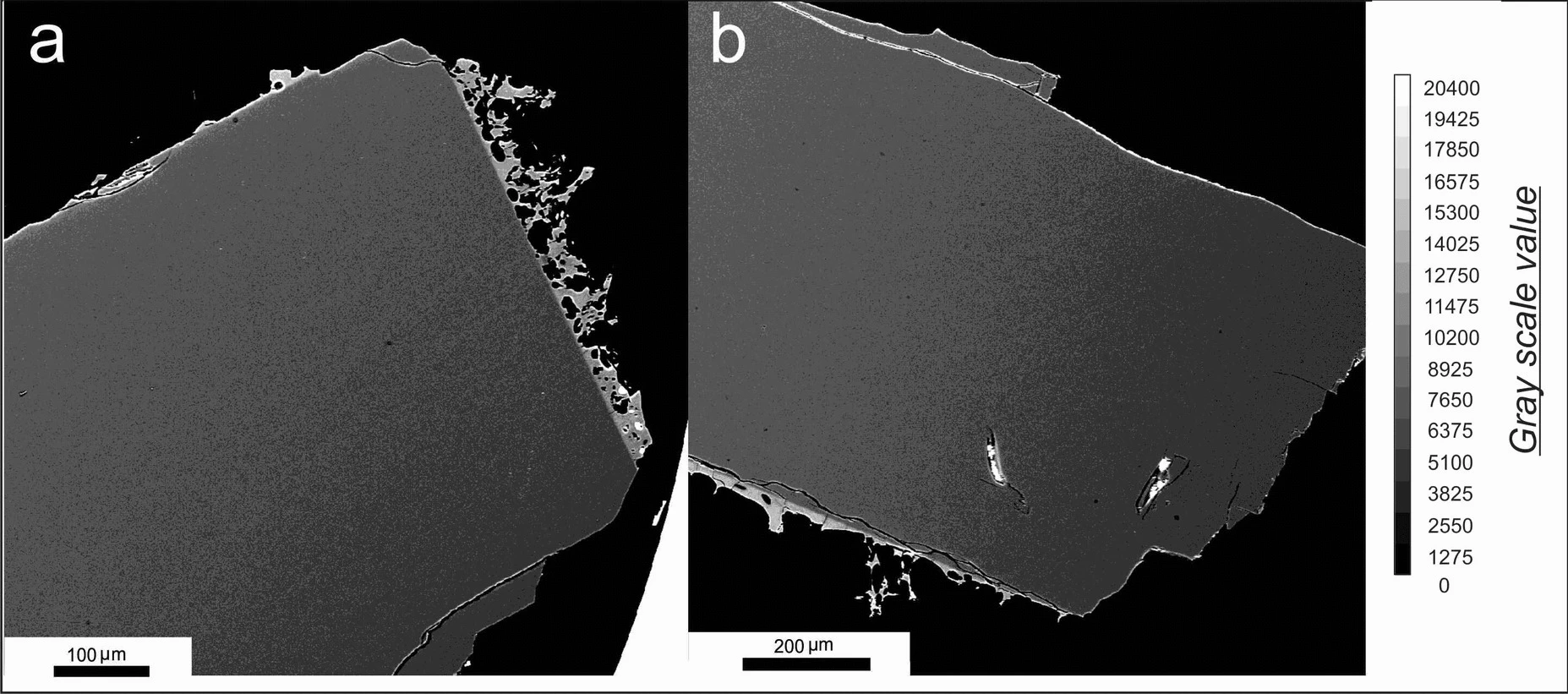Schnelle Bodenhebung bei Svartsengi auf Island hält an – Vulkanologen vorsichtig bei der Lageeinschätzung
 Der Boden auf Island hebt sich derzeit mit einem ähnlichen Tempo wie nach der initialen Gangbildung vom 10. November 2023. Damit dürfte das Hebungsniveau wieder in etwa dem Stand entsprechen, wie er bis ins Frühjahr 2024 hinein beobachtet wurde. Das bestätigen zwei isländische Geowissenschaftler in Zeitungsinterviews sowie in einem Artikel auf der Website des isländischen Wetterdienstes (IMO). Allerdings äußern sich die IMO-Wissenschaftler in ihrer Lageeinschätzung vorsichtig. Sie möchten weder genaue Zahlen nennen noch Prognosen treffen – dafür sei es noch zu früh, so ihre Einschätzung.
Der Boden auf Island hebt sich derzeit mit einem ähnlichen Tempo wie nach der initialen Gangbildung vom 10. November 2023. Damit dürfte das Hebungsniveau wieder in etwa dem Stand entsprechen, wie er bis ins Frühjahr 2024 hinein beobachtet wurde. Das bestätigen zwei isländische Geowissenschaftler in Zeitungsinterviews sowie in einem Artikel auf der Website des isländischen Wetterdienstes (IMO). Allerdings äußern sich die IMO-Wissenschaftler in ihrer Lageeinschätzung vorsichtig. Sie möchten weder genaue Zahlen nennen noch Prognosen treffen – dafür sei es noch zu früh, so ihre Einschätzung.
Klarer äußert sich hingegen der emeritierte Professor Haraldur Sigurðsson, der zuletzt an der Universität von Rhode Island lehrte und forschte. Er sieht im jüngsten Ausbruch – begleitet von der Bildung eines magmatischen Gangs und eines Rifts – ein Ereignis, das dem vom 10. November 2023 ähnelt. Wie ich ist auch er der Meinung, dass dieser Ausbruch die Karten neu gemischt und eine neue Eruptionsphase eingeleitet hat. Demnach befinden wir uns nun am Beginn der dritten Eruptionsphase, in der sich eine neue Ausbruchsserie entwickeln könnte – ähnlich der, die wir seit Ende 2023 erlebt haben.
Die erste Phase der Ereignisse dauerte bis März 2024. In diesem Zeitraum kam es in rascher Folge zu sechs Episoden mit Gangbildungen und Eruptionen. Die anschließende zweite Aktivitätsphase endete am 1. April mit den jüngsten Ereignissen. Diese Phase war von Eruptionen geprägt, die in größeren zeitlichen Abständen – teils mehr als drei Monate – auftraten und mit einer langsamen, aber stetigen Abnahme des Magmenaufstiegs vom tiefen zum flachen Reservoir einhergingen. Die Aufstiegsrate sank dabei von etwa vier auf 2,5 Kubikmeter pro Sekunde. Gleichzeitig nahmen die Eruptionen an Intensität zu.
Tatsächlich war das Ereignis vom 1. April stärker als das vorangegangene und gilt als das zweitstärkste seit Beginn der Unruhen bei Svartsengi: Rund 30 Millionen Kubikmeter Magma verließen das flach liegende Speicherreservoir unter Svartsengi und strömten in den magmatischen Gang. Nur ein vergleichsweise kleiner Teil der Schmelze gelangte bis an die Oberfläche und wurde eruptiert. Der sichtbare Teil des Ausbruchs dauerte rund vier Stunden.
Bereits zwei Tage nach dem Eruptionsbeginn setzte erneut Bodenhebung ein. Auch wenn viele Wissenschaftler betonen, es sei noch zu früh für eine belastbare Einschätzung der neuen Aufstiegsrate, gehe ich davon aus, dass sie deutlich über vier Kubikmetern pro Sekunde liegt. Ein doppelt so hoher Wert würde mich nicht überraschen. Was sich derzeit allerdings kaum abschätzen lässt, ist, wie lange diese hohe Aufstiegsrate anhalten wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass wir in wenigen Wochen einen weiteren Ausbruch erleben werden.